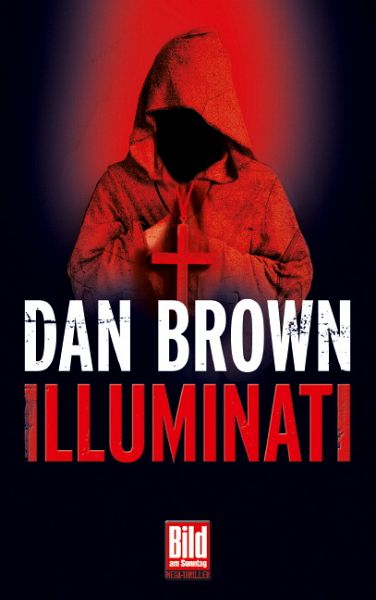 "Sein Lebenstraum war, Religion und Wissenschaft zu vereinen", sagte sie. "Er hoffte beweisen zu können, dass Religion und Wissenschaft zwei durchaus miteinander vereinbare Dinge seien - zwei verschiedene Wege zu ein und derselben Wahrheit." Sie zögerte, als glaubte sie slebst nicht an das, was als Nächstes kam. "Und vor kurzem... Fand er einen Weg dorthin." Kohler schwieg.
"Sein Lebenstraum war, Religion und Wissenschaft zu vereinen", sagte sie. "Er hoffte beweisen zu können, dass Religion und Wissenschaft zwei durchaus miteinander vereinbare Dinge seien - zwei verschiedene Wege zu ein und derselben Wahrheit." Sie zögerte, als glaubte sie slebst nicht an das, was als Nächstes kam. "Und vor kurzem... Fand er einen Weg dorthin." Kohler schwieg. "Er entwickelte ein Experiment, von dem er hoffte, das es einen der erbittersten Konflikte in der Geschichte von Wissenschaft und Religon beenden könnte."
Langdon fragte sich, welchen Konflikt sie meinte. Es gab zu viele.
"Die Schöpfung.", erklärte Vittoria. "Der Streit darüber, wie das Universum entstanden ist."
Oh, dachte Langdon. Dieser Streit.[...]
"Herr Direktor, die Wissenschaft behauptet das Gleiche wie die Religion, dass der Urknall alles im Universum zusammen mit seinem Gegensatz schuf."
"Einschließlich der Materie selbst", flüsterte Kohler wie zu sich selbst.
Vittoria nickte. "Einschließlich der Materie selbst. Und als mein Vater sein Experiment durch führte, entstanden zwei Formen von Materie."
"Langdon fragte sich, was das zu bedeuten hatte. Leonardo Vetra hat den Gegensatz zvon Materie erschaffen?
Kohler starrte sie ärgerlich an. "Die Substanz, auf die Sie hier anspielen, existiert irgendwo im Universum, aber ganz gewiss nicht hier! Sehr wahrscheinlich nicht einmal in unserer Milchstraße."
"Ganz genau.", erwiderte Vittoria. "Und das ist der Beweis dafür, dass die Partikel in diesen Behältern erschffen worden sein müssen!"
Kohlers Miene wurde hart. "Vittoria, Sie wollen doch wohl nicht behaupten, dass sich in diesen Behältern Proben davon befinden?"
"Genau das." Vittoria betrachtete stolz die Behälter. "Herr Direktor, vor sich sehen Sie die erste Antimaterie dieser Welt."
Illuminati - Dan Brown

















 Während Zoe das Schloss öffnete und Quentin einen halben Schritt schräg vor mir stand, betrachtete ich Zoes Hintern - es hätte einer übermenschlichen Anstrengung bedurft, woanders hinzusehen. Meine Fettpolster mögen ja seit zehn Jahren ein höchst überflüssiges östrogenartiges Hormon produzieren, aber ein bisschen Testosteron kreist doch auch noch in meinem Blut und bestimmt bei Gelegenheit den Fokus meiner Aufmerksamkeit. Als sie sich, immer noch vor dem Rad kauernd, plötzlich umdrehte und mir ins Gesicht sah, glitt mein Blick zwar automatisch mit Überlichtgeschwindigkeit auf das Fahrrad, aber für das sexuelle Sensorium einer Frau ist Überlichtgeschwindigkeit nicht schnell genug. Natürlich hatte sie die Fokusverschiebung mitgekriegt.
Während Zoe das Schloss öffnete und Quentin einen halben Schritt schräg vor mir stand, betrachtete ich Zoes Hintern - es hätte einer übermenschlichen Anstrengung bedurft, woanders hinzusehen. Meine Fettpolster mögen ja seit zehn Jahren ein höchst überflüssiges östrogenartiges Hormon produzieren, aber ein bisschen Testosteron kreist doch auch noch in meinem Blut und bestimmt bei Gelegenheit den Fokus meiner Aufmerksamkeit. Als sie sich, immer noch vor dem Rad kauernd, plötzlich umdrehte und mir ins Gesicht sah, glitt mein Blick zwar automatisch mit Überlichtgeschwindigkeit auf das Fahrrad, aber für das sexuelle Sensorium einer Frau ist Überlichtgeschwindigkeit nicht schnell genug. Natürlich hatte sie die Fokusverschiebung mitgekriegt.
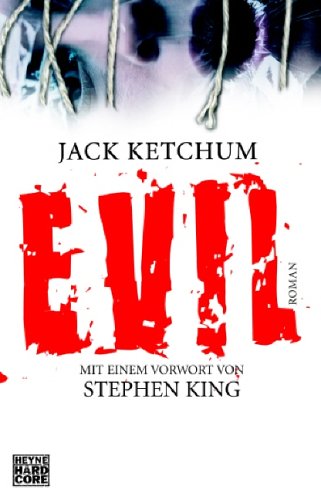
 Man hat die Geschichte von John und Yoko immer als die einer durchtriebenen, selbstherrlichen Frau dargestellt, die sich den berühmten Beatle bei ihrem ersten Treffen - oder vielleicht schon früher- als Beute wählte und ihn dann mit rücksichtslosem Einsatz verfolgte, bis sie ihr Ziel erreicht hatte. Dabei gibt es wohl kaum ein brühmtes Liebespaar, dass auf solchen Umwegen und mit so viel Bedenken auf beiden Seiten zueinanderfand wie dieses.
Man hat die Geschichte von John und Yoko immer als die einer durchtriebenen, selbstherrlichen Frau dargestellt, die sich den berühmten Beatle bei ihrem ersten Treffen - oder vielleicht schon früher- als Beute wählte und ihn dann mit rücksichtslosem Einsatz verfolgte, bis sie ihr Ziel erreicht hatte. Dabei gibt es wohl kaum ein brühmtes Liebespaar, dass auf solchen Umwegen und mit so viel Bedenken auf beiden Seiten zueinanderfand wie dieses.
 "Warte mal 'ne Minute. Ich werd dir was zu essen zurechtmachen. Vielleicht hast du's nötig."
"Warte mal 'ne Minute. Ich werd dir was zu essen zurechtmachen. Vielleicht hast du's nötig."